Die Vorstellung, dass eine lebensrettende Maßnahme wie die Wiederherstellung des Blutflusses paradoxerweise selbst Schaden anrichten kann, wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich. Doch genau dieses Phänomen – der sogenannte Reperfusionsschaden – stellt eine ernstzunehmende medizinische Herausforderung dar. Insbesondere in Bereichen der Kardiologie, der Transplantationsmedizin, bei Reanimationen oder bei Schlaganfällen tritt dieses Problem auf. Dabei stehen Ärzt:innen vor einem ethischen Dilemma: Die schnelle Intervention zur Rettung von Gewebe kann in manchen Fällen genau das Gegenteil bewirken. Dieser Aufsatz beleuchtet die pathophysiologischen Hintergründe, therapeutischen Strategien und ethischen Spannungsfelder rund um den Reperfusionsschaden.
Der doppelte Schaden
Man stelle sich vor, eine Stadt liegt nach einem Stromausfall im Dunkeln. Sobald der Strom wieder fließt, gehen nicht nur die Lichter an, sondern auch Sicherungen durch. Genau kann auch auch auf zellulärer Ebene passieren. Der Herzmuskel, zuvor durch den Gefäßverschluss unterversorgt (ischämisch), wird nach der Öffnung plötzlich von einer „Sauerstoffflut“ überschwemmt – und reagiert darauf nicht nur mit Erleichterung, sondern mit Entzündung, Zelltod und teils irreversibler Schädigung.
Der medizinische Begriff dafür heißt: Reperfusionsschaden. Er äußert sich in drei Formen:
- Myokardiales Stunning: eine Art „Schockstarre“ der Herzmuskulatur trotz lebender Zellen.
- Mikrovaskuläre Dysfunktion: kleinste Gefäße versagen trotz geöffneter Hauptarterie den Dienst.
- Lethale Zellnekrose: endgültiges Absterben von Zellen, unter anderem durch Kalziumüberladung und Sauerstoffradikale[1].
Ein Reperfusionsschaden (engl. Ischemia-Reperfusion Injury, IRI) bezeichnet die zellulären und strukturellen Schäden, die nach einer vorangegangenen Ischämie durch die Wiederherstellung des Blutflusses entstehen. In der Ischämiephase kommt es durch Sauerstoffmangel zu einem Abfall der ATP-Produktion, einer Akkumulation toxischer Metabolite und ersten Zellveränderungen. Paradoxerweise führt die Reoxygenierung dann zur Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), zur Kalziumüberladung und zur Aktivierung des Immunsystems, was den Zellschaden oft dramatisch verschärft.[2]
Besonders betroffen sind Organe mit hohem Sauerstoffbedarf wie das Herz, das Gehirn, die Nieren und die Leber. Beim Herzinfarkt kann die Reperfusion lebensrettend sein, aber auch Arrhythmien, Endothelschäden oder Infarktvergrößerung hervorrufen[3]. In der Lebertransplantation führt Reperfusion häufig zu Entzündungsschüben und erhöhter Abstoßungsgefahr[4].
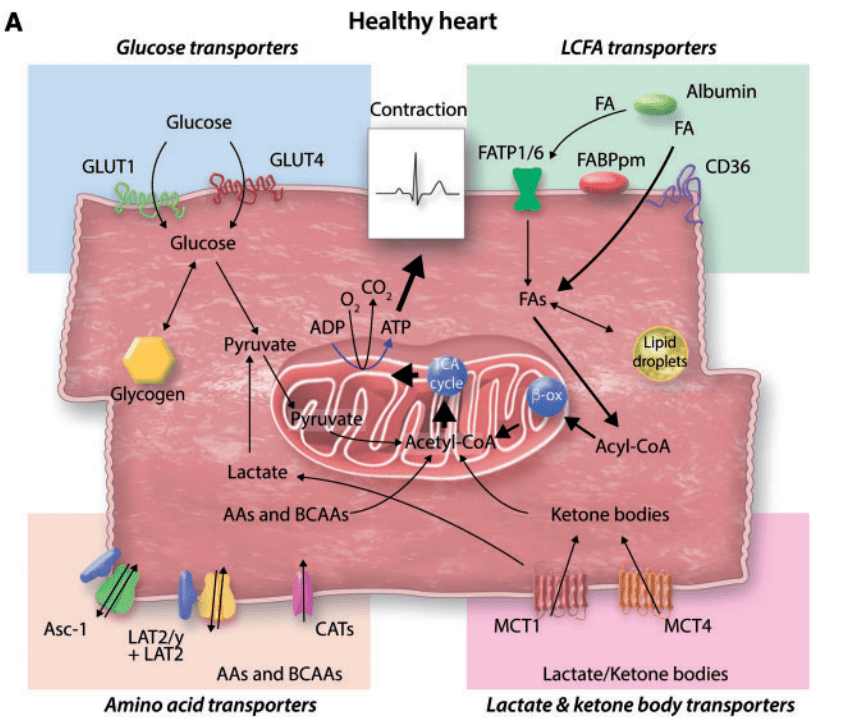
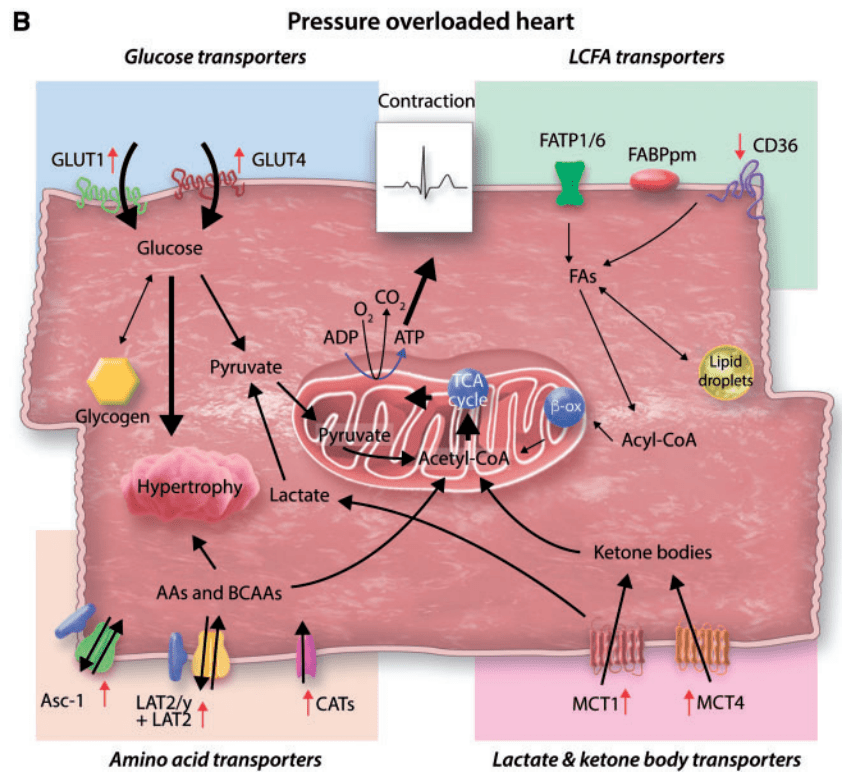
Das „No-Reflow“-Phänomen
Selbst wenn der Herzkatheter erfolgreich das Hauptgefäß öffnet, kann es passieren, dass das Gewebe downstream leer bleibt. Der Farbstoff in der Angiografie fließt nicht weiter – es bleibt „trocken“. Grund ist die Entzündungsreaktion in den Kapillaren: Schwellung, Verklebung, Funktionsversagen. Der Mediziner spricht vom No-Reflow – ein frustrierendes Ergebnis nach vermeintlichem Erfolg[1].
- Herzstillstand und Reanimation: Nach erfolgreicher Reanimation kommt es häufig zu systemischen Reperfusionsschäden, die als „Post-Reanimationssyndrom“ bekannt sind. Die Einleitung von Kühlung, möglicher antioxidativer Therapie und engmaschiger Überwachung sind ethisch geboten, aber oft von Ressourcen oder klinischer Erfahrung abhängig.
- Organtransplantation: In der Lebertransplantation ist die Reperfusionsphase entscheidend für das Gedeihen des Organs. Die dabei auftretende Immunaktivierung kann paradoxerweise zur Organabstoßung führen. Hier stellt sich die Frage: Wie viel Schaden darf man zulassen, um Leben zu retten?
Therapeutische Herausforderungen
Trotz intensiver Forschung existieren bislang kaum klinisch erprobte Therapien gegen Reperfusionsschäden. Ansätze umfassen pharmakologische Interventionen wie Antioxidantien, Kalziumkanalblocker, mPTP-Inhibitoren (z. B. Cyclosporin A) oder ischämisches Preconditioning[2]. Doch viele dieser Strategien befinden sich noch im experimentellen Stadium und sind nicht breit zugelassen.
Ein faszinierender Ansatz ist das sogenannte Remote Ischämic Preconditioning . Das gezielte, vorübergehende Abbinden einer anderen Körperregion (z. B. des Arms) mit einer Blutdruckmanschette, um Schutzsignale im Körper auszulösen. Klingt nach Magie, zeigte im Tiermodell auch Erfolge – aber scheiterte in großen klinischen Studien an der Realität[4].
Die klinische Praxis verlangt oft schnelle Entscheidungen unter Zeitdruck: Etwa bei der perkutanen Koronarintervention (PCI) nach Myokardinfarkt muss innerhalb von Minuten entschieden werden, ob eine Reperfusion eingeleitet wird. Hierbei stehen Mediziner:innen vor einem Spannungsfeld zwischen der Pflicht zur Lebensrettung und dem Risiko, durch die Therapie selbst Schaden zu erzeugen.
Ethische Problemfelder
Die ethischen Herausforderungen im Umgang mit Reperfusionsschäden lassen sich besonders eindrucksvoll anhand der vier Prinzipien der biomedizinischen Ethik nach Beauchamp und Childress analysieren: Autonomie, Nichtschaden, Fürsorge (Benefizienz) und Gerechtigkeit. Diese Prinzipien helfen, die moralische Komplexität klinischer Entscheidungen sichtbar zu machen – und stoßen in der Praxis akuter Notfalleingriffe dennoch an erkenntnistheoretische wie normative Grenzen.
Autonomie: In der Notfallmedizin ist der Grundsatz der Selbstbestimmung oft nicht umsetzbar. Eine informierte Einwilligung kann bei einem Herzstillstand oder einem akuten Myokardinfarkt nicht eingeholt werden. Stattdessen stützen sich Ärzt:innen auf den mutmaßlichen Willen der Patient:innen. Doch stellt sich die Frage, ob eine Einwilligung, die sich nicht ausdrücklich auf mögliche Folgekomplikationen wie Reperfusionsschäden bezieht, überhaupt als ethisch belastbar gelten kann.
Eine konkludente Einwilligung ist nur dann vertretbar, wenn die geplante Maßnahme mit den vernünftigen Erwartungen eines informierten Patienten vereinbar ist. Im Fall hochkomplexer oder kaum kommunizierter Nebenwirkungen wie IRI ist diese Voraussetzung fraglich. Daraus folgt: Die ärztliche Verantwortung umfasst nicht nur die unmittelbare Handlung, sondern auch eine reflektierte Nachsorge – inklusive transparenter Kommunikation über eingetretene Risiken.
Nichtschaden (Non-Malefizienz): Reperfusionsschäden konfrontieren die medizinische Ethik mit einem fundamentalen Dilemma: Eine Intervention, die Leben retten soll, bringt ihrerseits ein beträchtliches Schadenspotenzial mit sich.
Zwischen gerechtfertigtem Risiko und unvertretbarer Schädigung verläuft keine klare Grenze. Es bedarf daher eines verantwortungsvollen Umgangs mit Wahrscheinlichkeiten. Nur wenn das Risiko des Eingriffs geringer ist als das Risiko bei dessen Unterlassung, lässt sich die Maßnahme ethisch vertreten. Dies erfordert eine kontinuierliche Neubewertung etablierter Verfahren angesichts neuer Erkenntnisse.
Fürsorge (Benefizienz): Ziel jeder medizinischen Maßnahme muss es sein, das bestmögliche Wohl der Patient:innen zu fördern. Doch was „Wohl“ bedeutet, ist gerade bei IRI mehrdimensional: Überleben allein genügt nicht als Kriterium.
Ein umfassender Nutzenbegriff muss auch Lebensqualität, psychosoziale Faktoren und individuelle Präferenzen berücksichtigen. Gerade in späteren Therapieentscheidungen sollte dieser differenzierte Blick nachgeholt werden, wenn die akute Notsituation überstanden ist.
Gerechtigkeit: Der Zugang zu innovativen Therapien gegen Reperfusionsschäden ist ungleich verteilt. Manche Kliniken verfügen über spezialisierte Zentren und Forschungspartnerschaften, andere nicht.
Ethisch geboten ist eine gerechte Verteilung von Ressourcen – nicht nur in der Akutversorgung, sondern auch in der Translation medizinischer Innovationen. Wer profitiert von Forschung? Wer wird eingeschlossen? Gerechtigkeit verlangt strukturelle Korrektive in der Versorgungs- und Forschungspolitik.
Im Zentrum der ethischen Auseinandersetzung steht (natürlich) die Frage nach Verantwortung: Ist die behandelnde Person für einen Schaden verantwortlich, den sie nicht beabsichtigt, aber kausal ausgelöst hat?
Ja – im Sinne einer professionellen Rechenschaftspflicht. Verantwortung bedeutet hier nicht Schuld, sondern das aktive Bemühen um Transparenz, Lernfähigkeit und Prävention. Die moralische Integrität des ärztlichen Handelns bemisst sich nicht allein am Ergebnis, sondern auch an der Ernsthaftigkeit, mit der man sich mit Nebenwirkungen, Unsicherheiten und nicht-intendierten Folgen auseinandersetzt.
Nicht zuletzt werfen Reperfusionsschäden ein Schlaglicht auf die Risiken eines technikzentrierten Interventionsdenkens: Die Versuchung, jeder pathologischen Situation mit einem standardisierten Eingriff zu begegnen, kann zur Übertherapie führen. Mit ethisch fragwürdigen Folgen. Medizinethik muss daher nicht nur nachträglich legitimieren, sondern vorausschauend regulieren – insbesondere in klinischen Graubereichen, in denen Wissen, Risiko und Verantwortung im Fluss sind. der Medizin, die in einer Art „Interventions-Automatismus“ münden kann, ohne das individuelle Risiko-Nutzen-Verhältnis sorgfältig zu reflektieren. Medizinethik darf nicht nur retrospektiv rechtfertigen, sondern muss antizipierend mitdenken (Choosing-Wisely)– besonders in Grenzbereichen wie dem Reperfusionsschaden, in denen das Wissen noch im Fluss ist.
Der Blick ins Gesetz bleibt leer
Juristisch werden Reperfusionsschäden in der Regel als „typische Risiken„ eingeordnet, die bei korrekter Durchführung und hinreichender Aufklärung keine Haftung begründen[5]. Eine eigenständige rechtliche Kategorie für Reperfusionsschäden existiert nicht – weder in der Rechtsprechung noch in den maßgeblichen medizinrechtlichen Kommentaren[6]. Der Schaden bleibt somit strukturell „unschuldig“, obwohl kausal durch ärztliches Handeln ausgelöst.
Verantwortung ohne individuelle Schuld?
Die Frage nach Verantwortung stellt sich damit jenseits klassischer Haftungssysteme. Weder das Zivilrecht (Stichwort: Behandlungsfehler, § 280 BGB) noch das Strafrecht (fahrlässige Körperverletzung, § 229 StGB) greifen in solchen Konstellationen regelmäßig. Die Maßnahme war indiziert, die Durchführung lege artis, der Schaden unbeabsichtigt. Was bleibt, ist eine ethische Restverantwortung, die sich nicht aus der Rechtsordnung, sondern aus dem professionellen Ethos ärztlichen Handelns ableitet[7].
Die medizinethische Literatur betont hier zunehmend den Begriff der Accountability – also der Rechenschaftspflicht über das bloße juristische Schuldkonzept hinaus[8]. Verantwortung bedeutet in diesem Verständnis nicht nur die Einhaltung von Standards, sondern die antizipierende Reflexion über die Tragweite eigener Entscheidungen – insbesondere dort, wo epistemische Unsicherheit herrscht.
Diese ethisch relevante Zwischenform – nicht schuldhaft, aber auch nicht schicksalhaft – ist juristisch bislang unterbeleuchtet. Während das Arzthaftungsrecht fein zwischen Aufklärungs-, Organisations- und Diagnosefehlern unterscheidet, fehlt eine dogmatisch belastbare Kategorie für antizipierte, aber unvermeidbare Nebenwirkungen indizierter Maßnahmen. Die juristische Figur des „schicksalhaften Verlaufs“ greift hier zu kurz, weil Reperfusionsschäden nicht rein zufällig, sondern strukturell mit dem Eingriff verbunden sind.
Im Ergebnis bleibt ein Bereich struktureller Unverantwortlichkeit bestehen: Die Betroffenen tragen den Schaden, obwohl er kausal durch das System der Hochleistungsmedizin produziert wurde – und obwohl der Schaden nicht durch individuelles Fehlverhalten, sondern durch ein Zusammenspiel aus Indikationsdruck, technischen Standards und pathophysiologischer Komplexität entstanden ist.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die bestehende Rechtsdogmatik ausreichend ist, um mit solchen Fällen umzugehen. Es bedarf möglicherweise eines interdisziplinären Konzepts medizinischer Verantwortung, das über das Schuldkonzept hinausweist und auch Systemverantwortung und Vorsorgelogik integriert. Denkbar wäre die Einführung eines eigenen Komplexes von „strukturbedingten, erwartbaren Komplikationen“, die – analog zum Produkthaftungsrecht – nicht an individuelles Fehlverhalten geknüpft sind, aber dennoch Ausgleichs- oder Reflexionspflichten erzeugen könnten⁷.
Hier muss ausdrücklich und mit Nachdruck angemerkt werden, dass die Übertragung haftungsrechtlicher Kategorien aus dem Produkthaftungsrecht auf medizinisches Handeln nur sehr bedingt zulässig ist. Ärztliche Entscheidungen erfolgen in hochkomplexen, individualisierten Kontexten unter Bedingungen struktureller Unsicherheit – und lassen sich gerade nicht mit der standardisierten Herstellung technischer Produkte vergleichen. Während die Produkthaftung auf dem Prinzip der Fehlerfreiheit und Kontrolle basiert, operiert die klinische Medizin vielfach im Modus des „besten verfügbaren Wissens“ und situativen Ermessens. Eine Ausweitung juristischer Verantwortung auf strukturbedingte, nicht vermeidbare Komplikationen birgt daher das Risiko, in eine Überverantwortlichkeitsfalle zu geraten: Sie könnte Defensivmedizin fördern, klinische Handlungsspielräume einschränken und das Vertrauensverhältnis zwischen Ärzt:innen und Patient:innen unterminieren. Das Ziel eines erweiterten Verantwortungsbegriffs muss deshalb nicht in einer Individualhaftung liegen, sondern in der Entwicklung strukturierter Reflexions- und Kompensationsmechanismen auf systemischer Ebene.
In jedem Fall zeigt das Beispiel der Reperfusionsschäden, wie wichtig es ist, Verantwortung nicht ausschließlich juristisch zu denken, sondern auch ethisch, politisch und epistemologisch – insbesondere in einer Medizin, deren Grenzbereiche mit wachsender Frequenz erreicht werden.
Quellen
- [1] Soares, R. O. S., Losada, D. M., Jordani, M. C., Evora, P. R. B., & Castro-e-Silva, O. (2019). Ischemia/Reperfusion Injury Revisited: An Overview of the Latest Pharmacological Strategies. International Journal of Molecular Sciences, 20(20), 5034. https://doi.org/10.3390/ijms20205034
- [2] Verma, S., Fedak, P. W. M., Weisel, R. D., Butany, J., Rao, V., Maitland, A., … & Li, R.-K. (2021). Fundamentals of reperfusion injury for the clinical cardiologist. Cardiovascular Research, 117(12), 2624–2638. https://doi.org/10.1093/cvr/cvaa060
- [3] Ma, Z., Zhou, Y., Li, Y., Zhou, Y., Song, J., Li, Y., … & Zhang, M. (2023). Mechanisms and therapeutic targets of ischemia–reperfusion injury in liver transplantation. Signal Transduction and Targeted Therapy, 8, 221. https://doi.org/10.1038/s41392-023-01688-x
- [4] Heusch, G. (2019). Coronary microvascular obstruction: the new frontier in cardioprotection. Cardiovascular Research, 115(2), 232–240. https://doi.org/10.1093/cvr/cvz060
- Vgl. Kalogeris, T. et al.: Cell biology of ischemia/reperfusion injury, in: Int Rev Cell Mol Biol. 2012, 298, S. 229–317.
- Spickhoff, A. (Hrsg.): Medizinrecht, 3. Aufl., München 2020, § 630a BGB Rn. 27–34.
- BGH, Urteil v. 28.01.2014 – VI ZR 143/13; siehe auch Laufs/Katzenmeier/Rehborn: Arztrecht, 9. Aufl., Heidelberg 2022, § 18 Rn. 43–49.
- Martens, E.: Professionelle Verantwortung. Eine Ethik für die risikobehaftete Praxis, Frankfurt a. M. 2020, S. 72–90.
- Kass, N.: An Ethics Framework for Public Health, in: Am. J. Public Health, 2001, 91(11), S. 1776–1782.
- Strech, D. et al.: Was ist Überversorgung? Begriffsanalyse und ethische Implikationen, in: Bundesgesundheitsbl. 2014, 57, S. 446–453.
- Huster, S.: Medizinrecht und Systemverantwortung, in: JuS 2021, S. 609–615.