- Der kategorische Imperativ und seine Grenzen
- Moral in der Geschichte des Rechts
- Gegenwart: Moral unter Druck
- Wenn Haltung zur Abgrenzung wird
Wenn wir heute über Moral sprechen, geschieht das oft in Formeln. Wir erwarten Klarheit, Verlässlichkeit, Eindeutigkeit. Doch moralisches Handeln ist selten eindeutig – es liegt im Auge des Betrachters und ereignet sich immer in konkreten Situationen. In Beziehungen, Institutionen, Systemen. Gerade dort, wo Umstände mehrdeutig, widersprüchlich oder unlösbar erscheinen, wird Moral besonders herausgefordert. Sie soll Halt und Orientierung bieten, wo es keine festen Geländer gibt.
Schon während meines Studiums habe ich mich intensiv mit Hegels Begriff der Moralität beschäftigt, insbesondere mit seiner Kritik am kategorischen Imperativ Kants. In der Theorie klingt dieser Imperativ bestechend klar, doch in der Praxis reicht dieses Prinzip oft nicht aus.
Man denke etwa an medizinethische Dilemmata wie die Triage in einer überfüllten Notaufnahme. Oder an Whistleblower, die Missstände aufdecken und dafür bewusst Regeln verletzen, um größeren Schaden abzuwenden. Oder an Flüchtlingspolitik: Soll das individuelle Recht auf Asyl dem kollektiven Anspruch auf soziale Stabilität untergeordnet werden?
In solchen Fällen geraten moralische Prinzipien in Konflikt. Was, wenn zwei Maximen gleichzeitig gelten – wenn man sowohl die Wahrheit sagen als auch Schaden vermeiden will? Wenn Pflicht und Mitgefühl sich widersprechen? Genau hier stößt eine rein formale Ethik an ihre Grenzen. An diesem Punkt setzt Hegels Denken an. Er lehnt moralische Prinzipien nicht ab, doch er besteht darauf, dass Moral sich in der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit bewähren muss. Sie ist kein starres Regelwerk, sondern ein dynamischer Prozess. Sie lebt vom Spannungsverhältnis zwischen subjektivem Wollen und objektiver Welt und verlangt nicht Reinheit, sondern Verantwortung.
Diese Idee hat mich nachhaltig geprägt. In einer Seminararbeit habe ich sie erstmals systematisch entfaltet – und bis heute scheint sie mir aktueller denn je. Denn Moral beginnt nicht dort, wo wir uns zurückziehen, um allgemeine Regeln zu prüfen, sondern dort, wo wir handeln müssen, obwohl nichts eindeutig ist.
Der kategorische Imperativ und seine Grenzen


Kants kategorischer Imperativ gilt vielen als moralisches Totschlagargument: „Was wäre, wenn das alle täten?“ Diese Formel erscheint einfach, universell, logisch. Sie verspricht, moralisches Handeln durch einen Test auf Allgemeingültigkeit prüfen zu können. Und doch, so Hegel, bleibt diese Prüfung leer – weil sie sich auf die Form, nicht auf den Inhalt bezieht.
Hegels Kritik zielt insbesondere auf diese Leere und Abstraktheit des kategorischen Imperativs, der jede konkrete Handlung nur auf ihre Form, nicht aber auf ihre sittliche Wirklichkeit beurteile. Das moralische Subjekt bleibt in dieser Theorie isoliert, da es sich nicht zur Realität in ein Verhältnis setzt.
Hegel wirft Kant also nicht vor, dass er Moral überhaupt begründen will – sondern dass seine Begründung zu formalistisch ist. Wer nur fragt, ob eine Maxime verallgemeinerbar ist, fragt nicht danach, ob sie in einer konkreten Situation sinnvoll, gerecht oder lebbar ist. Das Sittliche, so Hegel, entsteht erst dort, wo der Wille in der Wirklichkeit Fuß fasst – nicht im luftleeren Raum reiner Vernunft.
Hegels Zumutung
Hegels Denken ist in dieser Hinsicht eine Zumutung: Es verlangt, Moral nicht als Entweder-Oder, sondern als Prozess zu begreifen, als dialektische Bewegung, in der der Einzelne seine Pflicht nicht gegen die Welt, sondern in ihr verwirklicht.
Das bedeutet: moralisches Handeln ist nicht die Anwendung eines festen Prinzips, sondern eine Auseinandersetzung mit Konflikten, Widerständen, Ambivalenzen.
Der moralische Wille muss in der objektiven Welt tätig werden und sich auf sie einlassen. Nur dort, in der Auseinandersetzung mit Institutionen, Gesetzen, sozialen Ordnungen, erweist sich Moralität als handlungsleitendes Prinzip.
Damit wird deutlich: Wer moralisch handelt, bewegt sich nicht auf sicherem Grund. Er riskiert Schuld, Missverständnis, Kritik. Aber genau das ist das Wesen der sittlichen Handlung, dass sie nicht rein bleibt, sondern sich in der Unreinheit der Welt bewähren muss.
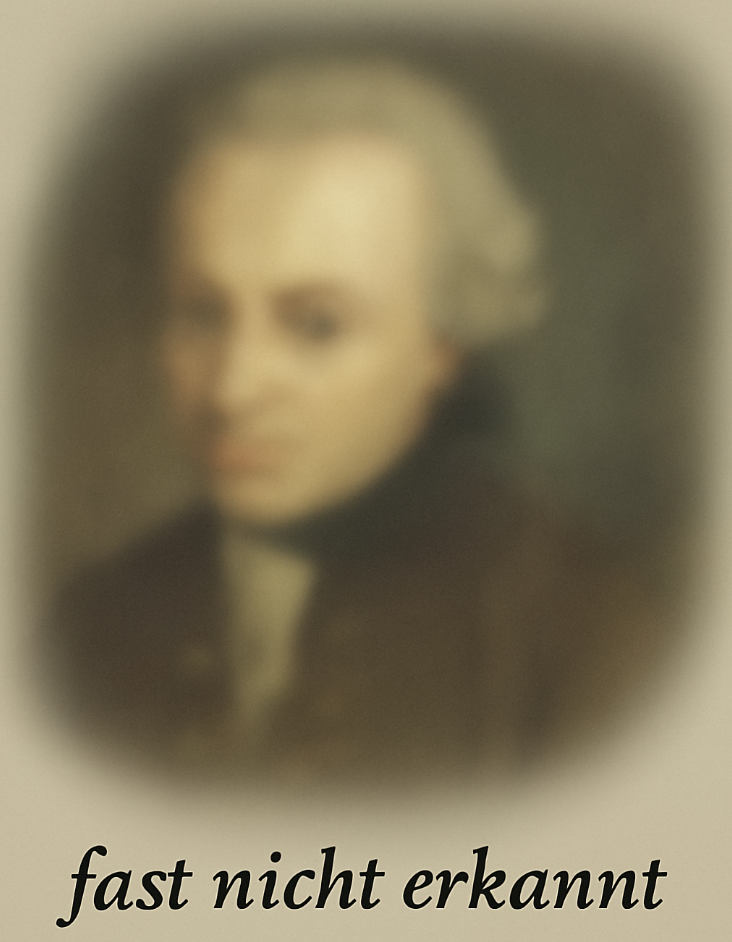
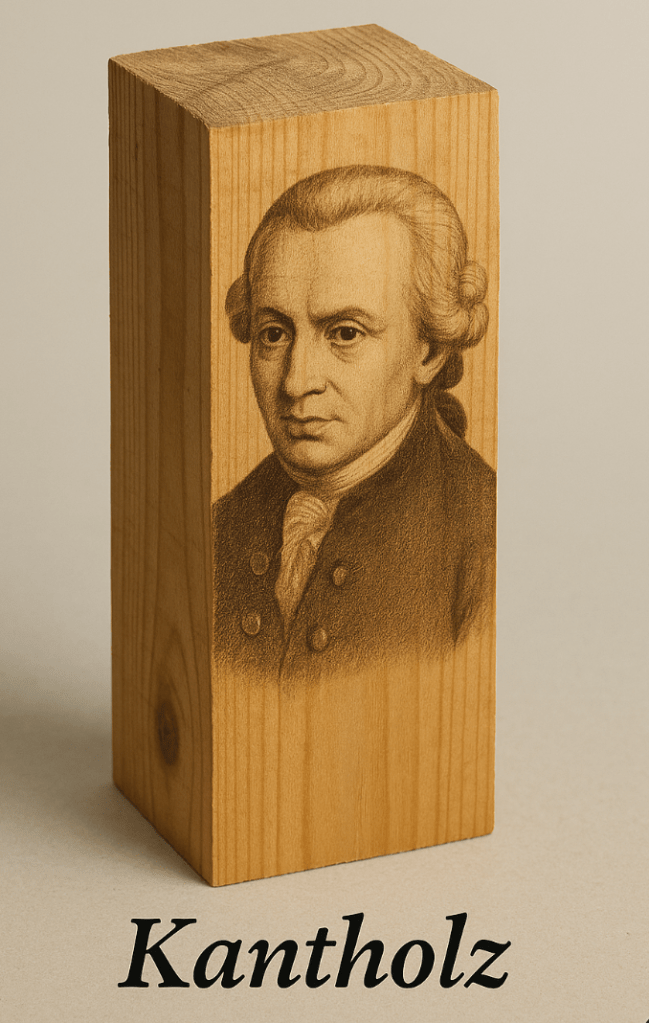
Moral in der Geschichte des Rechts
Diese Sichtweise findet ihre Entsprechung auch in der Rechtsgeschichte. Normen entstehen nicht im luftleeren Raum – sie sind Ausdruck eines moralischen Weltbildes, das sich historisch wandelt. Kaum ein Bereich macht dies so sichtbar wie das Recht.
Es gibt zahlreiche Beispiele für einst festgeschriebenes (Un)Recht: die Kriminalisierung von Homosexualität, die institutionalisierte Sklaverei oder die jahrzehntelange Strafbarkeit von Abtreibung. Doch besonders eindrücklich zeigt sich dieser Wandel am Beispiel eines Tatbestands, der heute kaum noch bekannt ist.
Tatbestand Kindstötung
In der Antike war die Tötung Neugeborener, etwa durch Aussetzung, weit verbreitet und gesellschaftlich akzeptiert. In Sparta galt sie sogar als Teil der staatlichen Gesundheits- und Auslesepolitik. Die römische patria potestas (väterliche Gewalt) gewährte Vätern das Recht, ungewollte Kinder zu töten oder auszusetzen. Auch im europäischen Mittelalter war Kindstötung – oft durch Mütter nach heimlicher Geburt – keine Seltenheit. Sie wurde moralisch zwar verurteilt, aber häufig als „Verzweiflungstat“ sozial isolierter Frauen interpretiert.
Mit dem Strafgesetzbuch des Deutschen Reichs von 1871 wurde die Kindstötung ein eigener Tatbestand § 217 StGB a.F.
„Eine Mutter, welche ihr nichteheliches Kind während oder gleich nach der Geburt tötet, wird wegen Kindesmordes mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft.“
Dieser Paragraph beruhte auf einem patriarchal geprägten Moralbild: Die „gefallene Frau“, die in ihrer Verzweiflung handelt, wird als moralisch angeschlagen, aber nicht völlig schuldfähig gesehen. Der Gesetzgeber unterstellte einen verminderten Verantwortungsgrad – psychisch, sozial, moralisch. Kindstötung wurde als „Sonderfall weiblicher Not“ behandelt und milder bestraft als Mord.
Diese Regelung hielt sich bis ins 20. Jahrhundert und wurde erst 1998 mit dem 6. Strafrechtsreformgesetz ersatzlos gestrichen. Seither wird jede Kindstötung wieder unter den allgemeinen Tötungsdelikten (§ 211 ff. StGB) geführt mit der Möglichkeit, mildernde Umstände im Rahmen der Strafzumessung (§ 46 StGB) zu berücksichtigen, aber ohne einen eigenständigen, moralisch-exzeptionellen Tatbestand.
Ist es nicht bemerkenswert, dass selbst nach Inkrafttreten des Grundgesetzes – mit seinem klaren Bekenntnis zur Unantastbarkeit der Menschenwürde – die Tötung eines Neugeborenen rechtlich nicht als Mord, sondern als milderer Sondertatbestand galt? Das ein hochmoralischen Rechtsstaat trotzdem zwischen einem „vollwertigen“ Erwachsenen und dem neugeborenen Kind unterschied?
Die Streichung des § 217 StGB markiert einen grundlegenden Wandel im rechtlichen und moralischen Umgang mit der Tat:
Nicht mehr das „Sittlichkeitsversagen“ der Frau steht im Zentrum, sondern die prinzipielle Gleichwertigkeit allen Lebens – unabhängig vom familiären oder sozialen Status. Die moralische Norm hat sich verschoben: weg vom Mitleid mit der Mutter, hin zur Betonung des Lebensschutzes des Kindes als vollwertigem Rechtssubjekt. Auch die Gleichstellung von nichtehelichen mit ehelichen Kindern im Familienrecht (1980er-Jahre) bereitete diesen Wandel moralisch vor.
Was bleibt, ist die Einsicht: Gesetze entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie reagieren auf gesellschaftliche Wertvorstellungen – und prägen diese wiederum zurück. Der „Fall“ der Kindstötung zeigt, wie das Recht moralische Bilder aufnimmt, institutionell verarbeitet und durch Reform transformiert. Er ist ein Beispiel dafür, wie moralische Urteile nicht verschwinden, sondern sich verschieben und neue Normen entstehen lassen.
Gegenwart: Moral unter Druck
In unserer Gegenwart scheint Moral allgegenwärtig. Auf Plakaten, in Diskursen, in Kommentaren. Aber diese Moralisierung geht oft mit einer paradoxen Leere einher. Alles muss moralisch sein, aber nichts darf mehr ambivalent sein. Jeder steht unter Rechtfertigungsdruck, jede Handlung wird sofort eingeordnet, bewertet, be- oder verurteilt. Dabei verliert die Moral ihre Bewegung – und wird wieder zur Regel.
Doch gerade jetzt braucht es Hegels Einsicht. Er fordert die Bereitschaft, sich die Hände schmutzig zu machen. Denn jede Handlung, die den Anspruch erhebt, moralisch zu sein, muss sich an der Wirklichkeit bewähren – und die ist nie rein.
Jeder Versuch, etwas in die Tat umzusetzen, bezieht sich auf das Gegenteil von dem, was angestrebt wird, nämlich die Wirklichkeit. Diese kann niemals rein sein, damit ist eine reine Pflichterfüllung niemals zu erreichen.
Die Vorstellung, dass Moral etwas Natürliches, Rein-Angeborenes sei, hält einer genaueren Prüfung nicht stand. Wäre das Moralgesetz ein Naturgesetz, dann wäre moralisches Handeln überflüssig – weil es keine Freiheit mehr gäbe, anders zu handeln. Genau darin liegt die Schwäche einer zu formalen Ethik: Sie entzieht dem Einzelnen die Verantwortung für seine konkreten Entscheidungen.
Das eigentlich Böse, liegt nicht im Verstoß gegen Normen, sondern in ihrer selbstgerechten Verallgemeinerung. Wer seine eigene Haltung zum Maßstab für alle erhebt, ohne sich der Wirklichkeit auszusetzen, entzieht sich dem moralischen Ernst. Umgekehrt bleibt selbst derjenige, der gegen moralische Normen handelt, aber ihre Geltung anerkennt, in einem gewissen Sinn moralisch anschlussfähig. Nicht das Scheitern ist das Problem – sondern die Weigerung, sich überhaupt einzulassen.
Anmerkung: An dieser Stelle könnte der Beitrag eigentlich enden. Doch als zeitdiagnostische Randnotiz sei noch ein Gedanke erlaubt – einer, der weniger philosophisch als politisch ist, aber das bisher Gesagte durchaus spiegelt.Wenn Haltung zur Abgrenzung wird
Ein Eindruck von Hegels Kritik an moralischer Selbstgewissheit zeigt sich auch in aktuellen politischen Debatten. Etwa dort, wo Teile des linksliberalen Milieus in Deutschland zunehmend den Vorwurf auf sich ziehen, Moral nicht mehr zu begründen, sondern nur noch zu behaupten. Der Vorwurf der „Selbstgerechtigkeit“, den Sahra Wagenknecht in ihrem gleichnamigen Buch (Die Selbstgerechten, 2021) gegen das linke Spektrum erhebt, zielt genau darauf ab. Es wird nicht mehr gerungen, sondern moralisch sortiert – in Zugehörigkeit und Ausschluss, in Haltung und Abweichung.
Ob man ihre politischen Schlüsse teilt oder nicht, der zugrunde liegende Befund verweist auf eine spürbare Verschiebung.Moral wird zunehmend zur Pose, zur rhetorischen Selbstvergewisserung, zur sprachlich makellosen Haltung, die mehr auf Wirkung als auf Wirksamkeit zielt. Statements ersetzen Handlung, Empörung ersetzt Auseinandersetzung. In dieser Dynamik droht der moralische Diskurs zur Bühne der Selbstprofilierung zu verkommen – ohne jede Zumutung durch Realität.
Wer sich jedoch ausschließlich in der moralisch sauberen Gesinnung einrichtet, läuft Gefahr, sich der Wirklichkeit zu entziehen. Hegel hätte dies als Flucht vor dem Ernst der Sittlichkeit gelesen: als Weigerung, sich in der Welt schuldig zu machen, um überhaupt wirksam zu sein. Es ist der Rückzug auf die abstrakte Richtigkeit auf eine Haltung, die lieber das Richtige sagt, als mit dem Falschen zu ringen. In diesem Sinne ist das Problem nicht die moralische Position selbst, sondern die moralische Selbstüberhöhung, die keine Widersprüche mehr zulässt.
Gerade eine demokratische Gesellschaft braucht aber Widerspruch und Widerspruchsfähigkeit. Denn Moral ohne Bezug zur Wirklichkeit verliert nicht nur ihren Ernst, sondern auch ihre Anschlussfähigkeit.
Wer sich abschottet, wird unhörbar. Und was als moralisches Prinzip begann, endet als politisch wirkungsloses Ritual.
Hinterlasse einen Kommentar