Dieses Essay ist im Wesentlichen inspiriert durch den Text von Jule Weber (2017) „Wo die Liebe hinfällt bleibt sie eben nicht einfach liegen“ 1 und wird ihn punktuell im Original zitieren. Mein Essay dient hier nicht als Fan-Hommage, sondern als Fallbeispiel, als verdichtete Szene einer spätmodernen Gefühlsökonomie, in der Nähe imaginiert, aber kaum noch gelebt wird. Denn Webers Text lässt sich mindestens dreifach lesen: als romantische Momentaufnahme, als Protokoll der Einsamkeit in überfüllten Räumen und als präzise Beschreibung einer Haltung, die Gefühle seriell testet, ohne je in wirkliche Beziehung einzutreten.
Die Stimme auf der Bühne beobachtet Fremde, schreibt ihnen Biografien, Eigenschaften und Vertrautheit zu – und bleibt doch konsequent im Einseitigen, folgenlos Schwärmerischen.
Hier liegen psychologische und soziologische Muster im Hintergrund, die sich in dieser seriellen Mikroverliebtheit zeigen, wie sie mit Projektion, parasozialen Momenten, den Normen öffentlicher Räume und spätmodernen Konzepten von „Liquid Love“ und emotionalem Kapitalismus verschränkt sind.
„Ich verlieb mich jeden Tag viermal“
Das lyrische Ich beschreibt, wie es sich im öffentlichen Nahverkehr, an der Supermarktkasse oder im Vorübergehen immer wieder kurz „verliebt“: in Unbekannte, deren Namen, Biografien und Inneres vollständig offen bleiben. Aus kleinen Details – Körperhaltung, Kleidungsstücke, Gesten, beiläufige Dialogsplitter – entstehen in Sekunden imaginierte Charaktere, mögliche Geschichten, potenzielle Beziehungen. Diese Gefühle sind intensiv genug, um als „Verliebtheit“ bezeichnet zu werden, und gleichzeitig so flüchtig, dass sie mit der nächsten Haltestelle oder der geschlossenen Tür wieder verschwinden.
Schon in dieser Konstellation steckt mehr als eine harmlose Romantisierung von Alltagsbegegnungen. Der Text markiert eine Gefühlsbewegung, die sich zwischen Überfüllung und Vereinzelung abspielt. Die Beziehungen bleiben anonym, bruchstückhaft, regellos. Gerade aus dieser Anonymität heraus bezieht das lyrische Ich seine Projektionsfläche. Die anderen werden nicht als konkrete Gegenüber sichtbar, sondern als Anlass, sich selbst als empfindsames, wahrnehmungsstarkes Subjekt zu inszenieren.
Diese Praxis ist ohne den Kontext moderner urbaner Lebensformen kaum zu verstehen. Georg Simmel (1903) beschreibt in seinem Essay über die Großstadt, wie die Überreizung durch Reize, Kontakte und Flüchtigkeit eine „Blasiertheit“ erzeugt, hinter der zugleich ein gesteigertes Bedürfnis nach Individualität und Besonderheit steht.2
Man könnte sagen: Ein Tag zwischen U-Bahn, Wartezimmer, Supermarkt und Timeline ist eine Abfolge von Gesichtern, Körpern, Geräuschen, Werbebildern, Nachrichten – so dicht, dass man sich ein dickes Fell zulegt, um nicht an jeder Ecke zu zersplittern. Und gerade wer abstumpft, fängt irgendwann an, sich einzelne Menschen herauszupicken, sie innerlich zu markieren.
„…du bist doch einfach so eine Apfel-Type mit dem Schal und der großen Tasche…“
Die seriellen Mikroverliebtheiten bei Weber lassen sich als Gegenbewegung zu dieser Abstumpfung lesen. Einzelne Figuren in der Masse werden kurzzeitig überaufgeladen, um dem eigenen Empfinden Bedeutung zurückzugeben – allerdings, ohne die Anonymität tatsächlich zu verlassen.
Hinzu tritt, was Erving Goffman (1963) als Norm der „civil inattention“ beschrieben hat. In öffentlichen Räumen gilt die Regel, andere zwar wahrzunehmen, ihnen aber diskret ihre soziale Integrität zu lassen, indem man sie nicht offen fixiert oder adressiert.3 Die Sprecherfigur folgt dieser Norm äußerlich – sie spricht die Beobachteten nicht an –, unterläuft sie aber innerlich, indem sie die Fremden detailliert ausdeutet und emotional okkupiert.
Ich beobachte das auch an mir selbst: wie schnell ich im Zug, im Wartebereich, an der Kasse Gesichter innerlich markiere, kleine Geschichten an sie hänge, nur um mir zu beweisen, dass da noch etwas in mir reagiert – und wie konsequent ich trotzdem sitzenbleibe, wenn sich die Möglichkeit eines wirklichen Gesprächs auftut.
Gerade diese Diskrepanz zwischen äußerer Zurückhaltung und innerem Überschuss macht den Text analytisch interessant: Er zeigt eine Gefühlsform, die sich perfekt in die höfliche Distanz öffentlicher Räume einfügt und zugleich eine verdeckte Aneignung der anderen vollzieht.
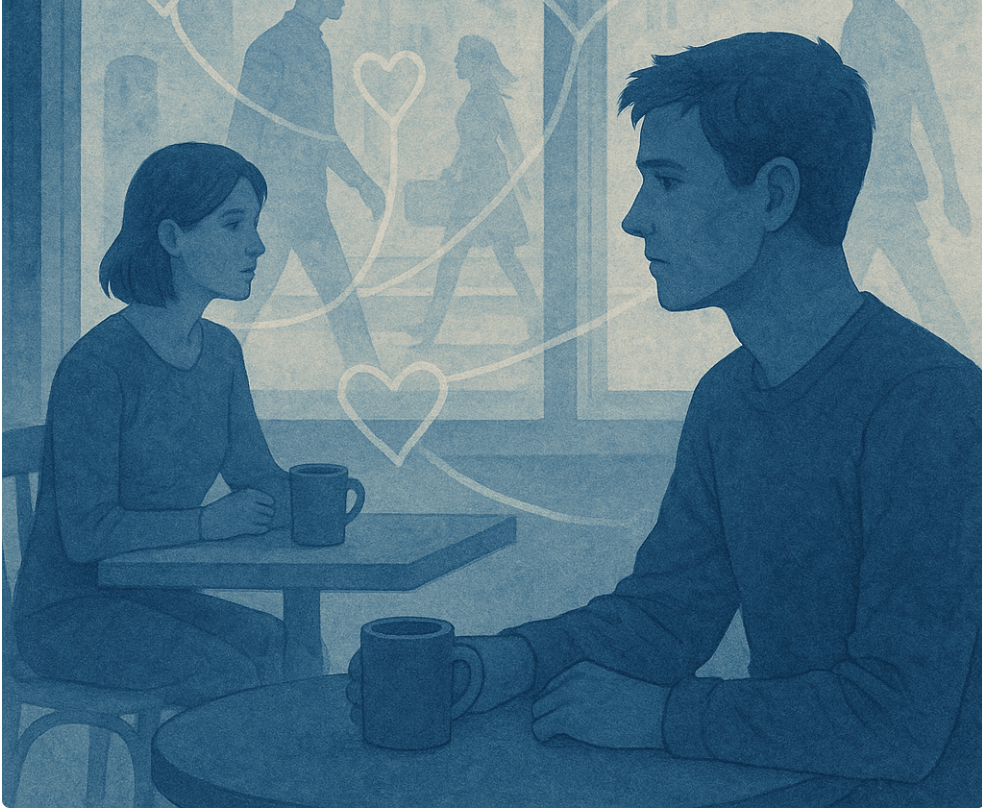
„Ich habe keine Ahnung, wer du bist […] aber ich glaube, du bist jemand, der sich merkt, ob man Kaffee oder Tee trinkt.“
Serielle Mikroverliebtheit entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern folgt erkennbaren psychologischen Mustern. Aus ein paar Sekunden Blickkontakt, einem Kleidungsstück, einer Geste werden ganze Biografien gebaut, inklusive Humor, Musikgeschmack, Charakterstruktur und Beziehungsfähigkeit. Die Fremden im Abteil oder an der Kasse sagen nichts, tun fast nichts – und werden doch zu Projektionsflächen für ein hochkomplexes inneres Drehbuch.
Ein erster Schlüssel dazu liegt in dem, was Nalini Ambady (1992) als „thin slices“ beschrieben hat. Menschen bilden aus extrem kurzen Verhaltensausschnitten – Sekunden von Mimik, Haltung, Stimme – erstaunlich stabile Urteile über Sympathie, Kompetenz oder Vertrauenswürdigkeit.4 Diese Urteile sind nicht völlig beliebig, sie können unter bestimmten Bedingungen durchaus Treffer landen. David Funder (2012) hat mit dem „Realistic Accuracy Model“ herausgearbeitet, dass Akkuratheit dann steigt, wenn relevante Hinweise sichtbar, bemerkt und richtig interpretiert werden.5 Im Alltag heißt das: Wir lesen tatsächlich einiges aus Körpern und Gesichtern und wir leiten daraus einen Wahrheitsanspruch ab.
„Du siehst aus wie ein Mann der Tim heißen könnte.“
Dies zu recht: Empirische Forschung zur nonverbalen Kommunikation zeigt, dass wir aus Körpern und Gesichtern tatsächlich mehr lesen können als bloßen Zufall. Schon extrem kurze Ausschnitte ermöglichen eine überzufällig genaue Einschätzungen etwa zu Extraversion, Dominanz oder Lehrkompetenz,6 bestimmte grundlegende Emotionen lassen sich in Gesichtsausdrücken relativ zuverlässig erkennen,7 und unsere ersten Eindrücke aus Gesichtern entstehen automatisch, schnell und sind sozial wirksam, selbst wenn sie verzerrt oder falsch sind.8 Zugleich machen Übersichtsarbeiten deutlich, dass nonverbale Signale nie eins zu eins „wahre Innenzustände“ abbilden, sondern kulturell gerahmt, situationsabhängig und interpretationsbedürftig bleiben.
Vielleicht wissen wir es nicht, aber wir wünschen uns, dass unsere Lesarten stimmen – und vielleicht sprechen wir die anderen gerade deshalb nicht an, um die Zerbrechlichkeit dieser Illusion nicht testen zu müssen.
„Wir sollten uns kennenlernen […], ich finde dich wirklich total super – aber stattdessen sag ich doch wieder nichts.“
Damit sind wir bei der Projektion, dem Mechanismus, bei dem eigene Wünsche, Ängste, Ideale unbemerkt nach außen verlagert und anderen zugeschrieben werden.9 In psychoanalytischer Tradition – von Freud bis zu den Objektbeziehungstheorien – gilt: Das, was wir in anderen „sehen“, ist oft eng mit unseren inneren Bildern verknüpft, mit verinnerlichten Beziehungserfahrungen und Selbstentwürfen.10 Bei Weber lässt sich das exemplarisch beobachten: Die Sprecherfigur „erkennt“ in vollkommen Unbekannten Menschen, die sich Kleinigkeiten merken, denselben Humor teilen, ähnlich fühlen, ähnlich hören. Faktisch wissen wir nichts, psychologisch betrachtet sehen wir ein Ich, das sich selbst in den anderen spiegelt und so die eigene Sensibilität bestätigt. Die vermeintliche Verliebtheit ist hier auch nur Selbstvergewisserung: Ich bin jemand, der tief schaut, der feine Unterschiede bemerkt, der zu großer Zärtlichkeit fähig wäre – wenn die Welt es zuließe. Wenn die Welt mich nur sehen würde.
„Ich habe keine Ahnung, wie du heißt und wo du herkommst und wohin du willst, aber o Himmel, was bin ich verliebt in dich.“
Diese Dynamik erhält eine zusätzliche Kontur, wenn man parasoziale Strukturen einbezieht. Horton und Wohl (1956) beschrieben parasoziale Interaktionen ursprünglich als einseitige „Scheinbeziehungen“ zu Medienfiguren, bei denen Nähe erlebt wird, ohne dass tatsächliche Gegenseitigkeit besteht.11 Überträgt man dieses Konzept auf Webers Szenen, erscheint das lyrische Ich als jemand, der solche einseitigen Intimitäten in den Alltag hinein verlängert. Die Menschen im Zug werden ähnlich behandelt wie eine vertraute Figur aus einer Serie – man kennt sie „gefühlt“, ohne sie zu kennen. Das Entscheidende ist hier aber, die emotionale Aufladung ist echt, sie ist risikolos, weil sie an keiner Stelle auf reale Antwort angewiesen ist. Die andere Person bleibt stumm, und genau das macht die Intensität kontrollierbar.
Webers serielles Verlieben ist keine pathologische Fixierung, sondern eine leichtere, schnell drehende Variante desselben Grundmusters: kurze, intensive Aufmerksamkeitsbündelung, starke Aufwertung des Gegenübers, sofortige Rücknahme, sobald der Rahmen (die Haltestelle, die Kasse, der Seminarraum) endet.
Zusammengenommen entsteht so ein klares Bild. Die serielle Mikroverliebtheit ist das Produkt eines Zusammenspiels aus kognitiven Routinen (schnelle Urteile), psychodynamischen Mechanismen (Projektion), eingeübten parasozialen Mustern (einseitige Intimität) und unserer Kultur, in der Gefühle möglichst intensiv, aber auch möglichst beherrschbar sein sollen.
Die Fremden bieten Anlass, eine innere Bühne zu betreiben, auf der Verbindung durchgespielt werden kann, ohne Verpflichtung, ohne Widerstand, ohne Zurückweisung. Das macht diese Form der Verliebtheit so attraktiv – und zugleich so kompatibel mit einer Lebensweise, die Bindung als Option verwaltet. Genau an dieser Stelle schließt dann die sozialtheoretische Perspektive an, in der von „Liquid Love“ und emotionalem Kapitalismus die Rede sein wird.
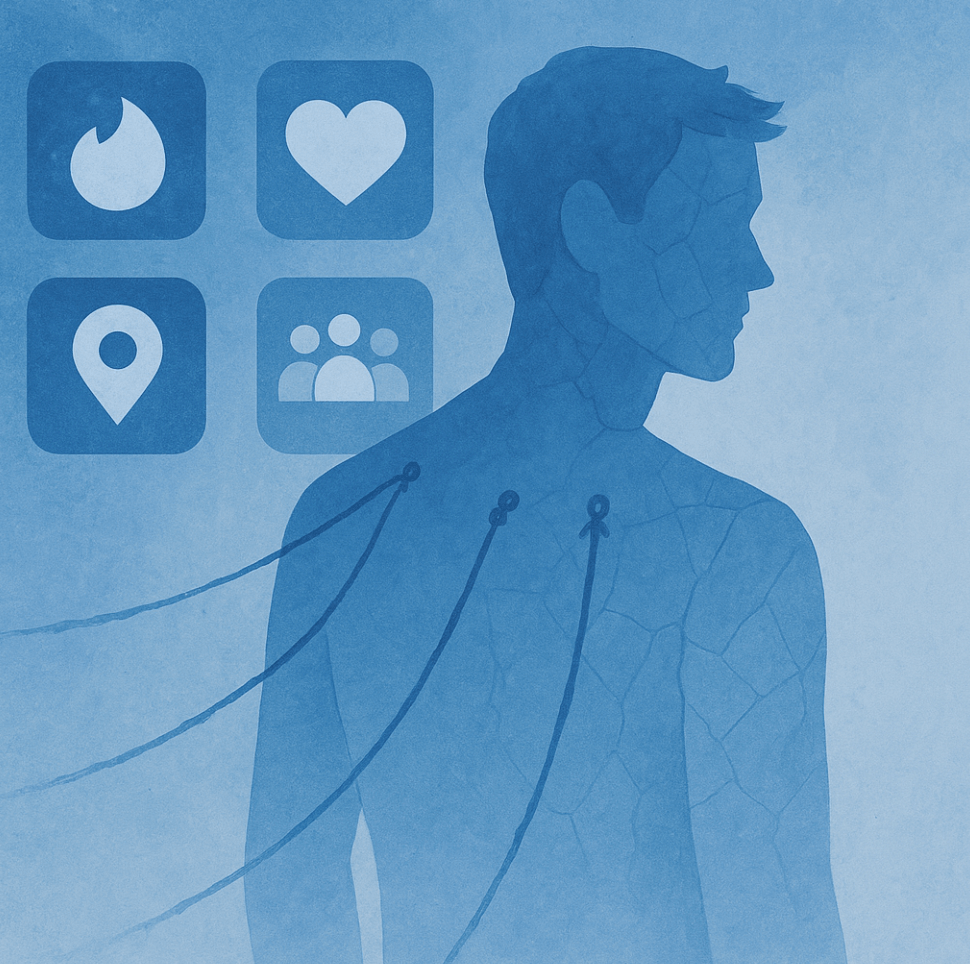
Mikroverliebtheit als kompatible Beziehungsform unserer Zeit
Die bisher skizzierte psychologische Mechanik bleibt nicht privatpsychologisch stehen. Sie ist eingebettet in eine Gefühlsordnung, die Zygmunt Bauman (2003) als Signatur der „flüssigen Moderne“ beschrieben hat. In „Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds „analysiert Bauman, wie Bindungen in spätmodernen Gesellschaften zugleich intensiv gewünscht und strukturell prekär organisiert sind.12
Beziehungen sollen Nähe, Sicherheit und emotionale Aufladung liefern, ohne dabei Autonomie, Wahlfreiheit und future options einzuschränken. Der Leitkonflikt lautet: Bedürfnis nach Verlässlichkeit vs. der Wunsch, jederzeit aussteigen zu können.
Bauman beschreibt den „flüssig-modernen“ Menschen als Figur, die Bindungen bevorzugt, die sich „leicht lösen“ lassen. Verbindungen, die stark genug sind, um emotional bedeutsam zu wirken, aber so gestaltet, dass sie ohne übermäßige Kosten gekappt werden können, wenn sich Umstände, Präferenzen oder Angebote ändern. In dieser Logik werden Beziehungen tendenziell reversibel, provisorisch, „auf Probe“ gestaltet, oder wie meine Generation es euphemistisch laybelt „Situationship“ – nicht unbedingt aus Zynismus, sondern als Antwort auf Unsicherheit und Überforderung. Man will sich nicht festlegen, solange die Welt permanent Alternativen verspricht.
Vor diesem Hintergrund erscheinen die seriellen Mikroverliebtheiten bei Jule Weber als nahezu ideale Gefühlsform der flüssigen Moderne. Wenn das lyrische Ich sagt, es verliebe sich „jeden Tag viermal“ in wechselnde Fremde, dann ist das mehr als eine poetische Übertreibung. Es ist ein Muster radikal folgenloser Bindung auf Zeit. Die emotionalen Miniaturen erfüllen zentrale Kriterien von Baumans (2003) „liquider“ Liebe:
- 1. Intensität ohne Vertrag
- 2. Reversibilität und Austauschbarkeit
- 3. Risikominimierung
- 4. Kontrollierte Nähe
Die Stimme auf der Bühne spielt mit der Geste der totalen Hingabe, während sie faktisch eine Gefühlsform präsentiert, die perfekt kompatibel ist mit der Logik einer Gesellschaft, in der Beziehungen getestet, konsumiert, unterbrochen und ersetzt werden können. Die „Liebe“, von der der Text spricht, ist nicht falsch oder unecht – sie ist nur von vornherein so gebaut, dass sie niemandem wehtun muss. Genau darin liegt ihre Anschlussfähigkeit an unsere flüssige Moderne. Also darf es nicht als privates Versagen verstanden werden, sondern als Strukturelles. Wir haben gelernt dauerhafte Verbindlichkeit als Risiko und nicht als Ressource zu codieren.
Wer mit Mitte zwanzig zwischen befristeten Verträgen, überfüllten Timelines, schleichender Erschöpfung und halbabgebrochenen Geschichten sitzt, der lernt, Gefühle so zu dosieren wie alles andere auch: kurz, kontrollierbar, jederzeit abbrechbar. Serielle Mikroverliebtheit passt dazu. Sie bestätigt, dass da noch etwas in einem lebt – ohne die Zumutung, diesem Leben einen anderen Menschen zuzumuten. Beziehungsweise nur auf begrenzte Zeit.
Emotional Capitalism: Mikroverliebtheit im Marktmodus
Wenn Bauman (2003) die Struktur der flüssigen Liebe beschreibt, liefert Eva Illouz das Anschlussgutachten dazu, wie sich Gefühle und Marktlogiken ineinander verschieben.
In Arbeiten wie Consuming the Romantic Utopia (1997), Cold Intimacies (2007)und Why Love Hurts (2012) zeigt sie, dass romantische Liebe längst nicht mehr der Gegenpol zum Kapitalismus ist, sondern in seine kulturellen und ökonomischen Formen eingebettet. Werbung, Popkultur, Plattformen und Therapiediskurse erzeugen ein Gefühlsrepertoire, in dem Intimität kalkuliert, optimiert und als Projekt an der eigenen Persönlichkeit geführt wird. 13 Gefühle werden heute nicht mehr einfach erlebt, sie werden als etwas verstanden, das gemanagt, reflektiert, begründet und – im Zweifel – besser gemacht werden muss. Illouz spricht von Emotional Capitalism, um diese Verschmelzung zu fassen – Wirtschaftliche Beziehungen werden emotionalisiert, intime Beziehungen nach Modellen von Tausch, Investition und Performance organisiert.14
Wenn sich das lyrische Ich jeden Tag viermal verliebt, dann ist das die Grammatik eines Subjekts, das gelernt hat, Optionen zu erzeugen. Jede Person im Abteil, an der Kasse, in der Schlange wird kurz auf ihren Möglichkeitswert abgeklopft: Könnte da etwas sein? Könnte ich mich in dir erkennen? Könnten wir die gleiche Musik hören? Diese Fragen bleiben unausgesprochen, aber strukturieren den Blick.
Illouz zeigt, dass moderne Subjekte ihre Beziehungen unter Bedingungen permanenter Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit führen. Profile, vergangene und mögliche Partner:innen, Lebensentwürfe stehen gleichzeitig im Raum, reale und imaginierte Alternativen sind nie weit weg. In Webers Text spiegelt sich genau diese Logik:
„Ich verlieb mich jeden Tag vier Mal. Mal für einen Moment oder für fünf Minuten, für acht lange Tage oder einen einseitigen Blick.“
Die Verliebtheit funktioniert wie ein emotionales Produkt, das kurzfristig konsumiert wird, ohne sich festzulegen. Zugleich lässt sich in dieser Haltung ein Subjekt erkennen, das seine eigene Empfindungsfähigkeit ausstellt. In einer Kultur, die Authentizität, Tiefe und Emotionalität permanent abfragt, im Bewerbungsgespräch, im Profiltext, in der Therapie, in „Wer bin ich eigentlich?“-Narrativen.
Hier schreit das lyrische Ich geradezu „Ich spüre viel. Ich könnte lieben.“ Die Mikroverliebtheit dient so auch als Selbstbeschreibung im Code des emotionalen Kapitalismus. Als Nachweis von Sensibilität, ohne den Preis echter Bindung zu zahlen. Illouz argumentiert, dass genau diese Verschränkung – intensive Selbstreflexion, hoher Anspruch an Liebe, gleichzeitige Marktlogik der Wahlfreiheit – strukturell dazu beiträgt, dass Beziehungen fragil und entkoppelt werden. Mikroverliebtheit ist dann nicht einfach „süß“, sondern eine passgenaue Gefühlsform für ein System, das ständige Verfügbarkeit von Optionen verlangt und Entschiedenheit sanktioniert.
So gelesen, steht Webers Text an der Schnittstelle von Bauman und Illouz: Er zeigt ein Ich, das flüssige, reversible Gefühle produziert und sie gleichzeitig in einer symbolischen Ökonomie verwertet, in der Empfindsamkeit selbst zum Kapital wird. Die romantisierte Beobachtung im Zug ist damit nicht nur Poesie, sondern auch Symptom: Sie markiert, wie tief Marktlogiken in unsere intimsten Regungen eingedrungen sind – bis in den Moment, in dem wir jemanden betrachten, der drei Sitze weiter einfach nur dasitzt und nichts von der Geschichte weiß, die wir aus ihm machen.
Warum es weh tut – und was uns trotzdem bleibt
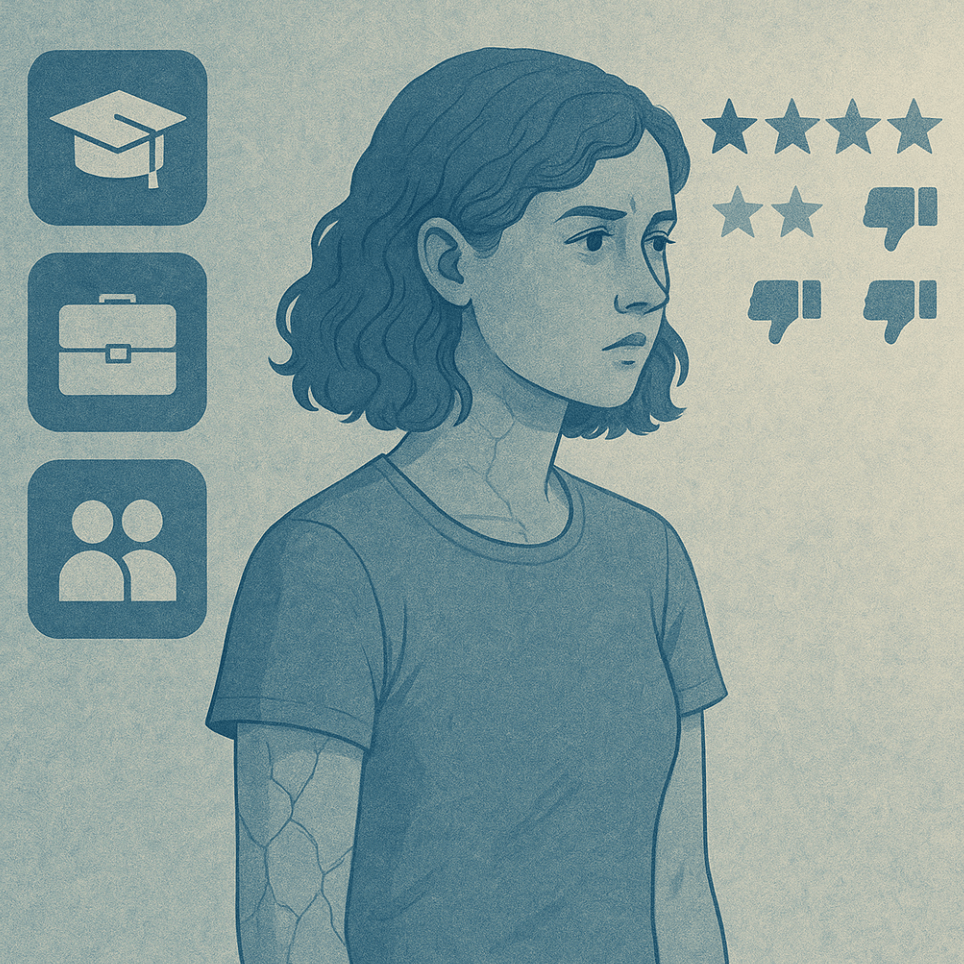
Warum scheint diese serielle, folgenlose Verliebtheit vor allem diejenigen zu prägen, die um die Jahrtausendwende geboren wurden – stärker als die Generation ihrer Eltern? Unsere Eltern sind, bei allen Brüchen, noch in einer Welt sozialisiert worden, in der bestimmte Strukturen zumindest als stabil galten: Ausbildung, Beruf, Partnerschaft, Freundeskreis – das waren Felder, in denen man bleiben konnte, ohne sich permanent rechtfertigen zu müssen. Dauerhafte Bindung war kulturell eher Norm als Risiko. Wer sich band, galt nicht als naiv, sondern als erwachsen.
Wir wuchsen eher in Krisen (Finanz-, Klima-, Pandemie-, politische Krisen) und in einer technische Infrastruktur auf, in der Profile, Kontakte und Beziehungen von Anfang an sichtbar vergleichbar, bewertbar und ersetzbar waren und nach wie vor sind. Die Erfahrung von Prekarität, Beschleunigung und ständiger Option ist kein theoretischer Aufsatzstoff mehr, sondern die Grundfarbe unseres Lebens.
In so einem Setting wirkt Verbindlichkeit nicht wie ein Schutzraum, sondern wie eine Gefährdung der eigenen Beweglichkeit. Wer nie sicher sein konnte, ob der Studiengang hält, der Job bleibt, die Stadt bezahlbar ist, erlebt „für immer“ weniger als Versprechen, eher als Drohung.
Hinzu kommt: Digitale Sozialität und Plattformlogiken trainieren von früh an, Menschen als wählbare, vergleichbare Optionen zu sehen – klickbar, löschbar, ersetzbar. Was Bauman als flüssige Moderne beschreibt und Illouz als emotionalen Kapitalismus analysiert, wird für diese Generation nicht nachträglich erfahrbar, sondern ist ihr Ausgangspunkt. Vor diesem Hintergrund ist Webers Mikroverliebtheit fast folgerichtig: ein Gefühlshaushalt, der Nähe ins Innere verlegt, weil draußen alles zu beweglich ist.
Und genau deshalb trifft uns das härter. Wir spüren den Mangel an wirklicher Bindung nicht trotz, sondern wegen ihrer hohen Sensibilität für Möglichkeiten – und hängen in der Differenz zwischen dem, was strukturell nahegelegt wird (reversibel bleiben) und dem, wonach sie sich existenziell sehnen (jemandem zumuten dürfen, der bleibt).
Das hat einen längeren Rattenschwanz, als es auf den ersten Blick wirkt. Wer Beziehungen vor allem als reversible Konstellationen einübt, verschiebt oder vermeidet auch Entscheidungen, die echte Irreversibilität markieren würden – Zusammenziehen, langfristige Verpflichtung, Kinder. Der sichtbare Geburtenrückgang in vielen europäischen als Folge von Mikroverliebtheit darzustellen wäre natürlich zu viel, aber mit Sicherheit ist es Symptom derselben Architektur aus Unsicherheit, Optionalisierung und chronisch vertagter Verbindlichkeit.
Jule Webers Text lässt sich so als schonungslos höfliche Bestandsaufnahme lesen. Er verklärt nichts, er beschönigt nichts, er zeigt eine Gefühlsform, die gleichzeitig Schutzschild und Symptom ist. Wenn wir ihn ernst nehmen, dann nicht, indem wir Mikroverliebtheit romantisieren oder pathologisieren, sondern indem wir sie als logische Antwort auf unsere Verhältnisse begreifen – und uns trotzdem fragen, wo wir ihr widersprechen können. Vielleicht bleibt uns am Ende nur diese kleine Unhöflichkeit gegenüber der flüssigen Moderne: gelegentlich den Sprung aus der sicheren Projektion in eine wirkliche Begegnung zu wagen.
- Jule Weber(2017) Youtube, [Kampf der Künste TV]: https://youtu.be/7ABk8LLlpf8 ↩︎
- Georg Simmel (1903) „Die Großstädte und das Geistesleben“, in: Die Großstädte und das Geistesleben, Dresden 1903. ↩︎
- Erving Goffman(1963), Behavior in Public Places. Notes on the Social Organization of Gatherings, New York. ↩︎
- Nalini Ambady / Robert Rosenthal (1992): „Thin slices of expressive behavior as predictors of interpersonal consequences: A meta-analysis“, in: Psychological Bulletin 111 (1992), S. 256–274. ↩︎
- David C. Funder (2012): „On the accuracy of personality judgment: A realistic approach“, in: Psychological Review 102 (1995), S. 652–670; ders.: „Accurate Personality Judgment“, in: Current Directions in Psychological Science 21 (2012), S. 177–182. ↩︎
- Nalini Ambady / Robert Rosenthal: (1992) „Thin Slices of Expressive Behavior as Predictors of Interpersonal Consequences: A Meta-Analysis“, Psychological Bulletin 111 (1992), S. 256–274. ↩︎
- Ekman, Paul / Friesen, Wallace V. (1971): Constants across cultures in the face and emotion. In: Journal of Personality and Social Psychology, 17(2), S. 124–129. DOI: 10.1037/h0030377. ↩︎
- Sigmund Freud: „Psycho-Analytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia paranoides)“, 1911; ↩︎
- Donald W. Winnicott (1953): „Transitional Objects and Transitional Phenomena“, in: International Journal of Psycho-Analysis ,34 (1953), S. 89–97; ↩︎
- Donald Horton / R. Richard Wohl (1956): „Mass Communication and Para-Social Interaction: Observations on Intimacy at a Distance“, in: Psychiatry 19 (1956), S. 215–229. ↩︎
- Zygmunt Bauman(2003): Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds. Cambridge 2003. ↩︎
- Illouz, Eva: Consuming the Romantic Utopia. Love and the Cultural Contradictions of Capitalism. Berkeley: University of California Press 1997. ↩︎
- Illouz, Eva: Cold Intimacies. The Making of Emotional Capitalism. Cambridge: Polity Press 2007. ↩︎
Hinterlasse einen Kommentar